


Wir leben in Zeiten von multiplen Krisen. Ob Klima–, Biodiversitäts–, Wirtschafts– oder Bildungskrise – das System, in dem wir leben, treibt Krisen voran und es ist wichtiger denn je, diesen mit echten Lösungen und Alternativen entgegenzutreten.
Als GRAS haben wir klare Visionen für eine zukunftsfähige Hochschule und Gesellschaft. Doch Visionen müssen auch umgesetzt werden. Tagtäglich engagieren wir uns aktiv für die Verbesserung von Studienbedingungen sowie für gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die über den Hochschulkontext hinaus wirken.
Wir konnten bereits vieles erreichen, doch noch ist es zu früh, um sich zurückzulehnen. Im letzten Jahr lag der durchschnittliche globale Temperaturanstieg erstmals über 1,5 Grad. Wetterextreme wie Stürme, Dürren und Hagel sind längst keine Ausnahme mehr und auch in Österreich spürbar. Zahlreiche Ökosysteme sind unumkehrbar beschädigt. Millionen von Menschen müssen fliehen, weil ihre Lebensgrundlagen
klimakrisenbedingt zerstört werden. Ohne rasche Handlungen droht die Klimakrise zur Klimakatastrophe zu eskalieren. Auch das Bildungssystem steht vor tiefgreifenden Problemen: Unser Bildungssystem entwickelt sich zunehmend zu einem Ausbildungssystem, das schnelle Einspeisung in den Arbeitsmarkt über den Beitrag zur gesellschaftlichen und persönlichen Entfaltung stellt. Die schleichende Ökonomisierung und Entdemokratisierung der Bildung sind alarmierende Entwicklungen, die dringend gestoppt und umgekehrt werden müssen. Gerade jetzt muss die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) eine entschlossene und kritische Stimme sowie ein Sprachrohr für Studierende in gesellschaftlichen Debatten sein. Gerade jetzt braucht es eine ökologische, progressive, antifaschistische und inklusive ÖH, um Hochschulen und Gesellschaft zum Besseren zu verändern.
Gerade jetzt braucht es eine lautstarke GRAS.
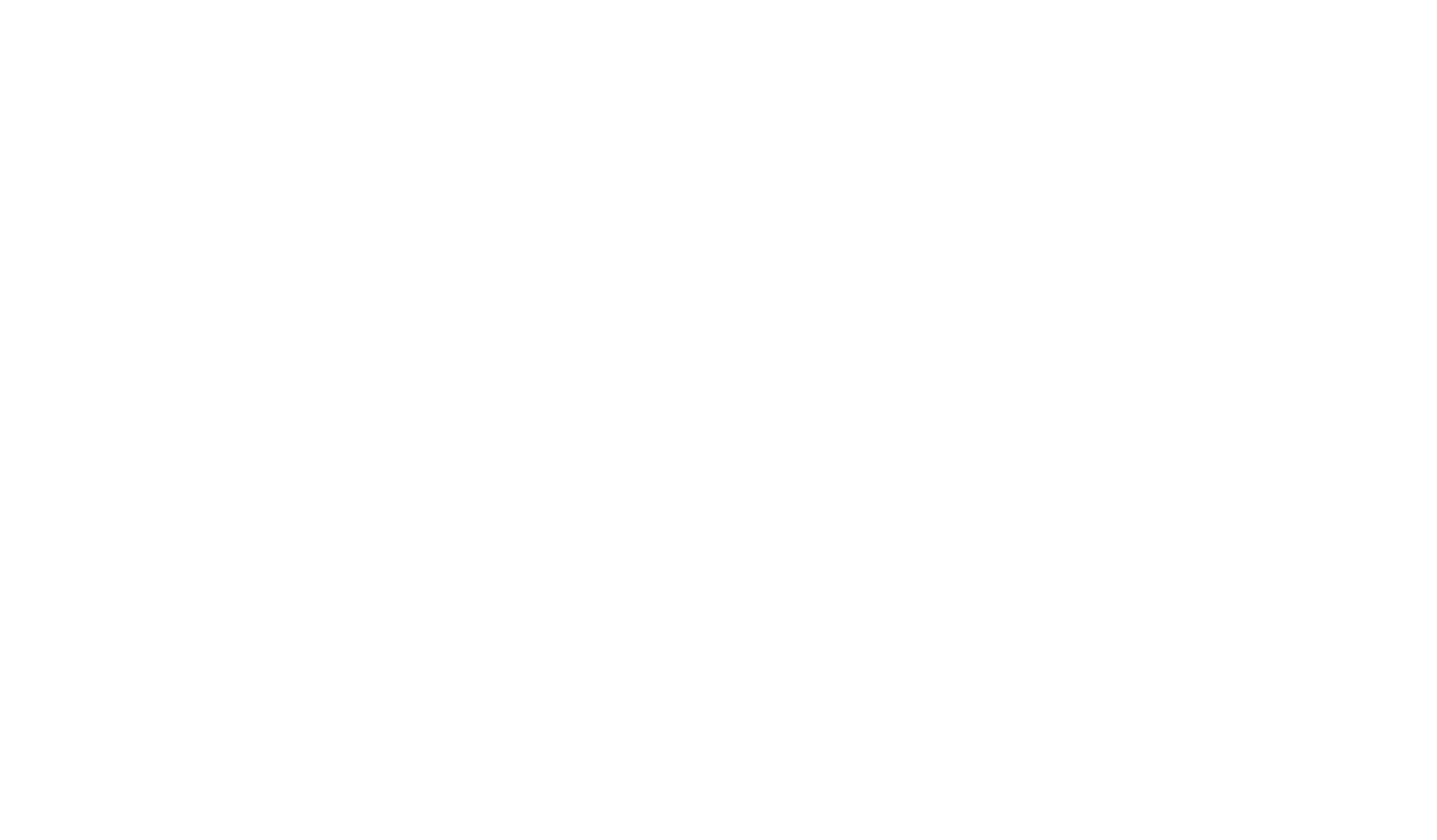
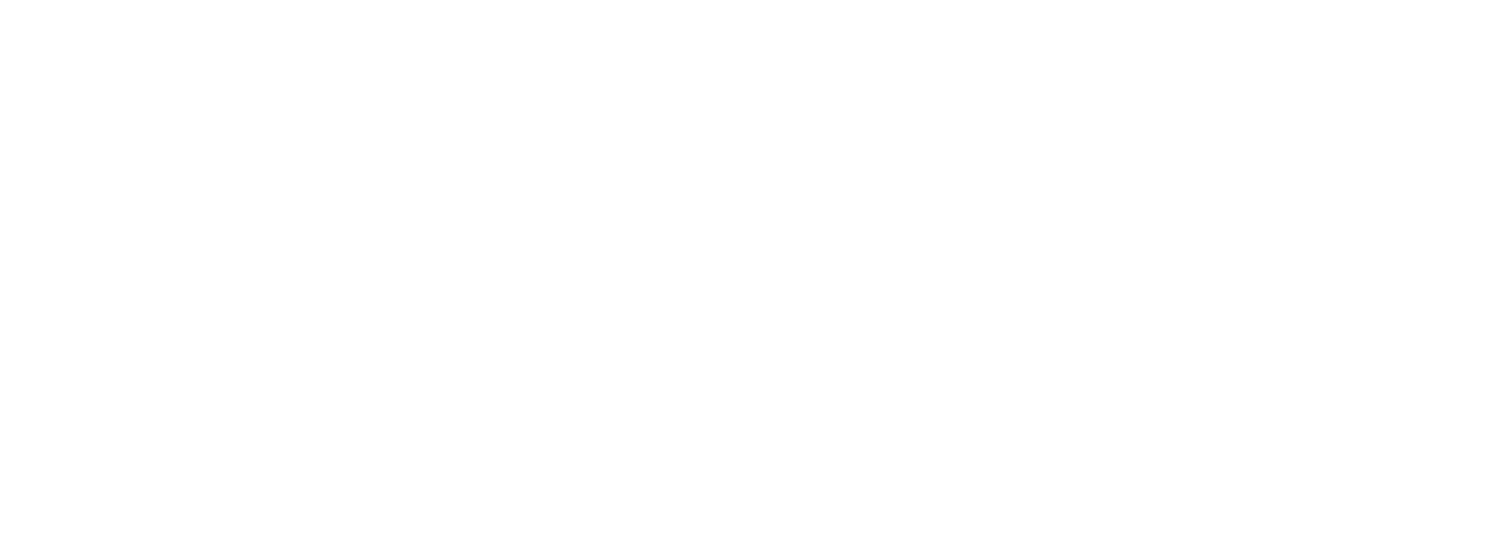
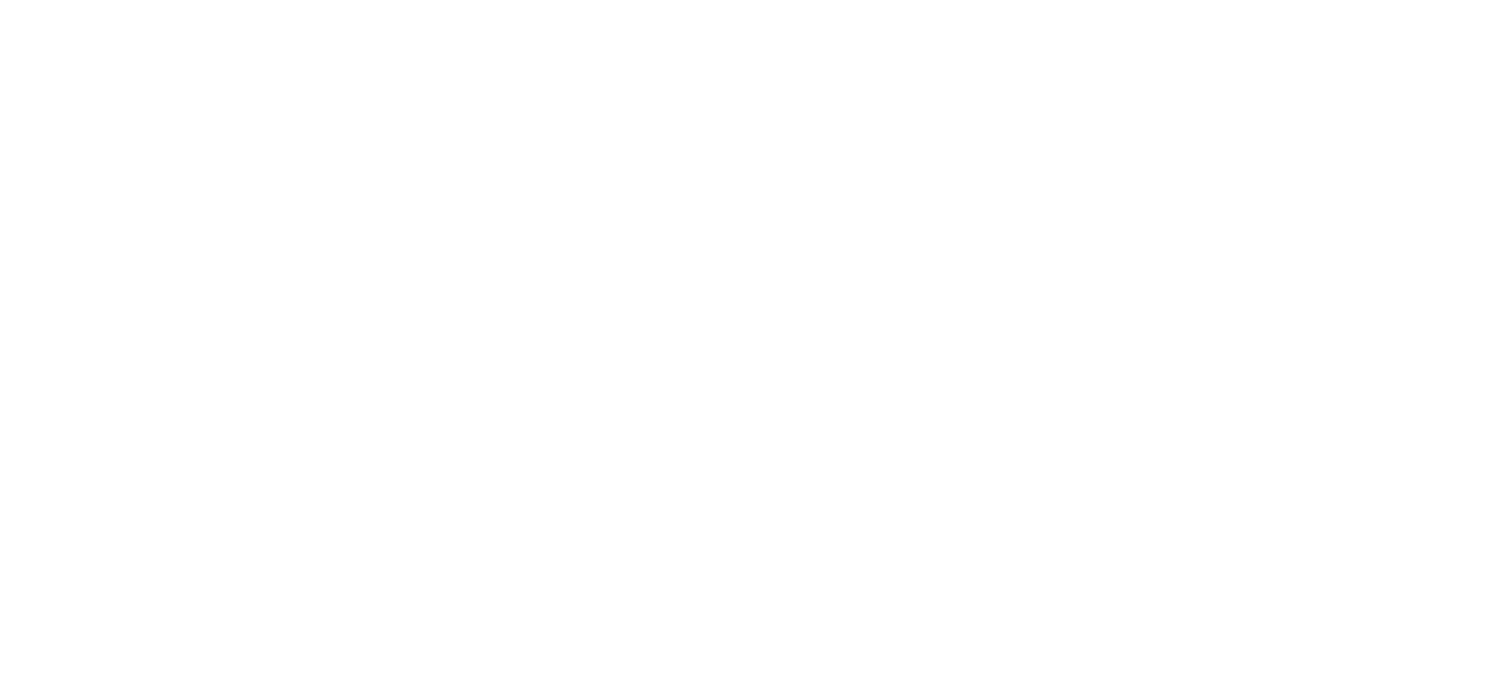
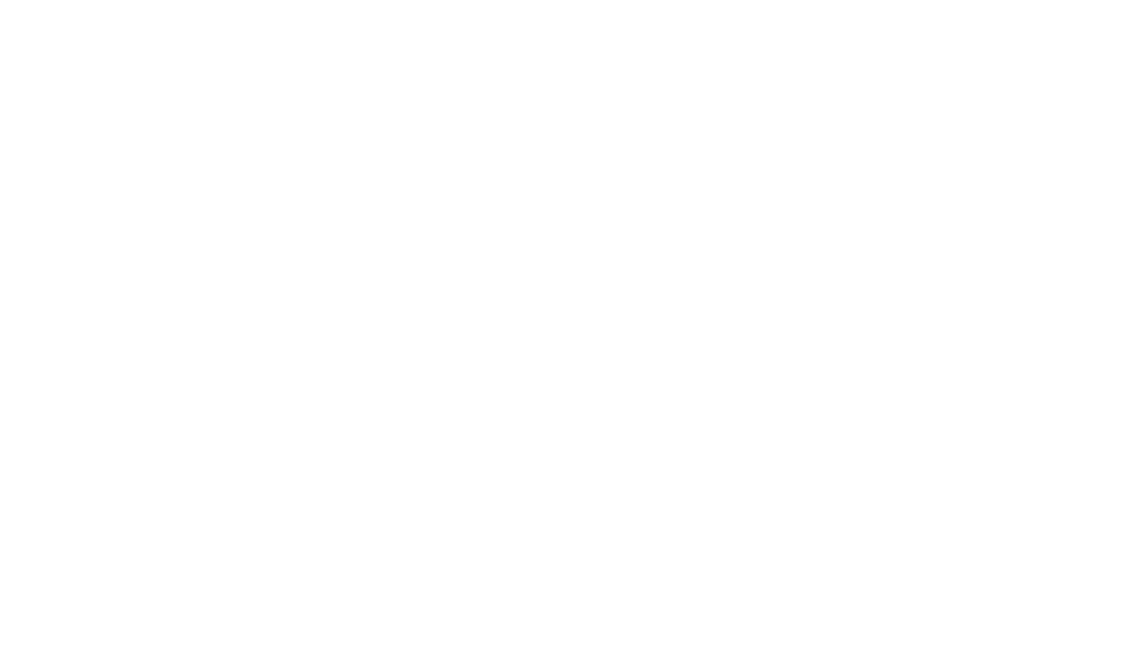

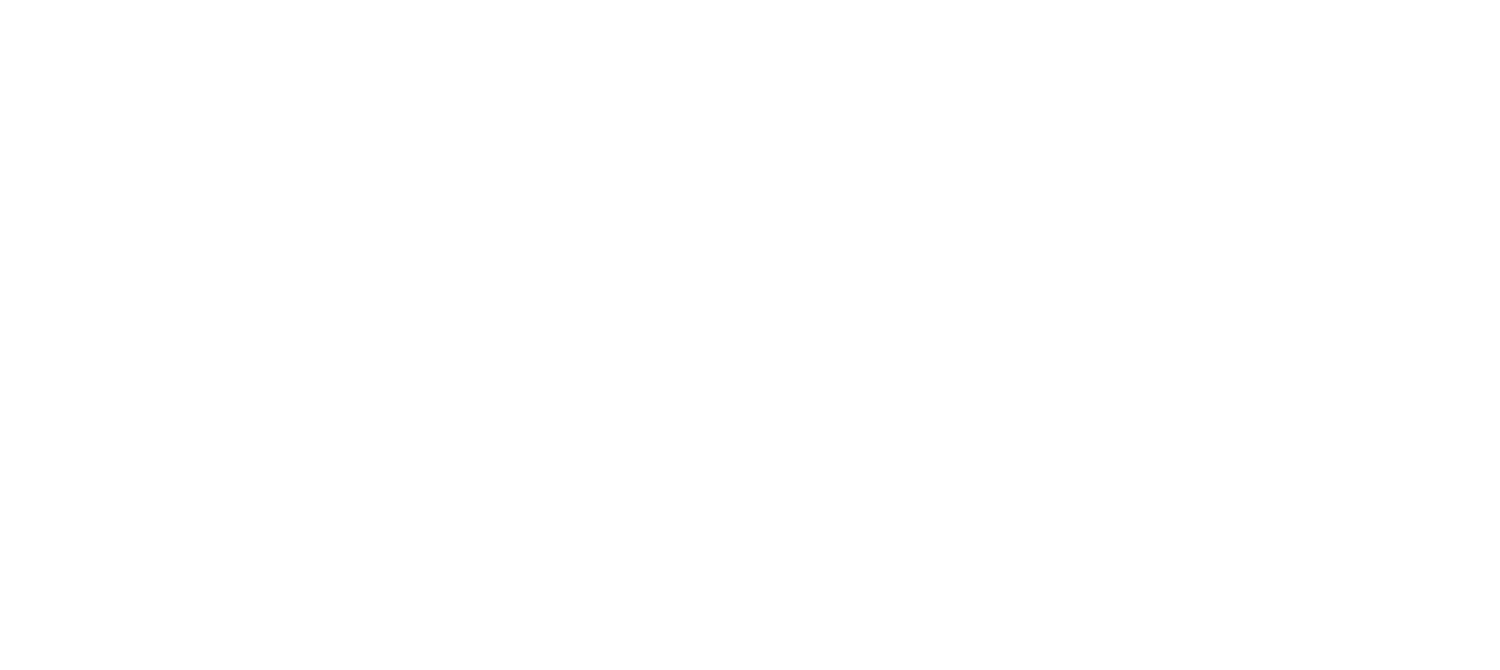
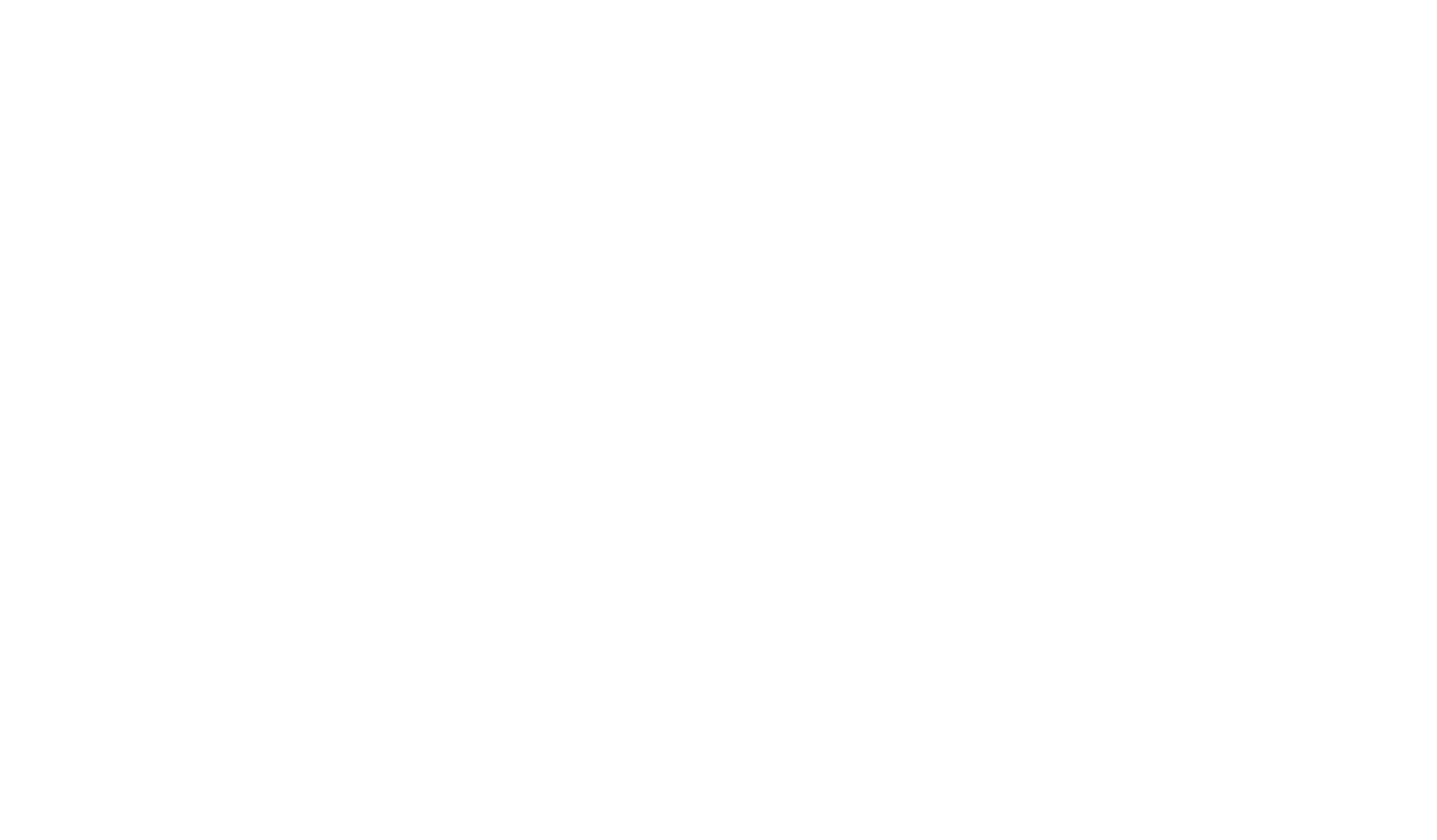
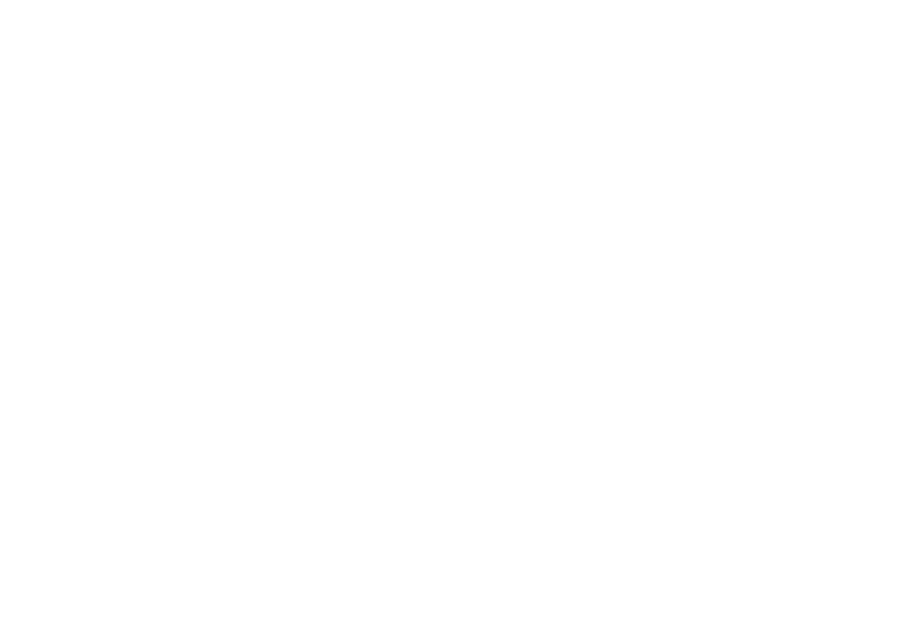
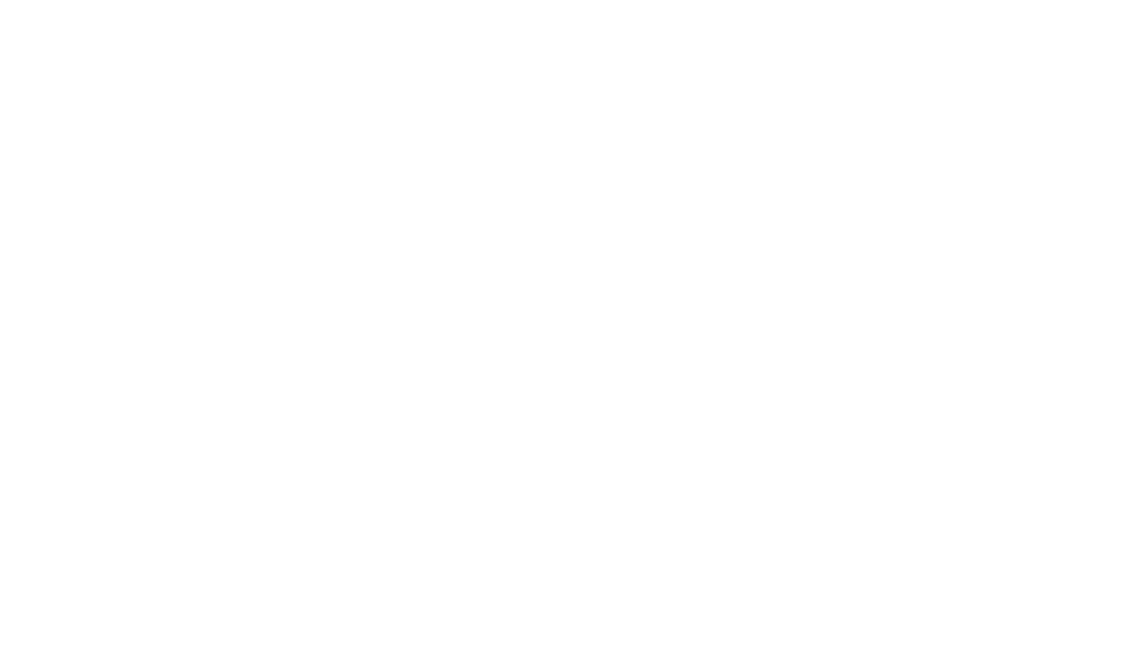

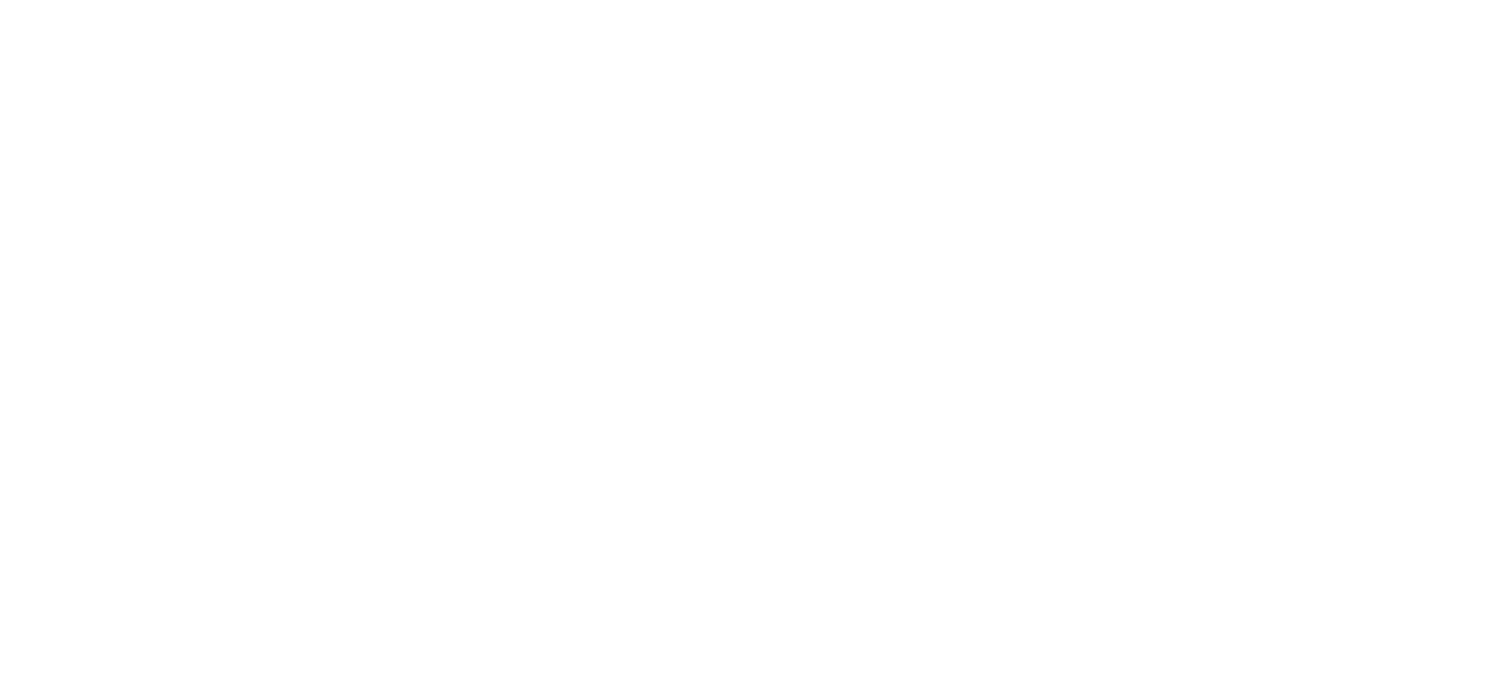
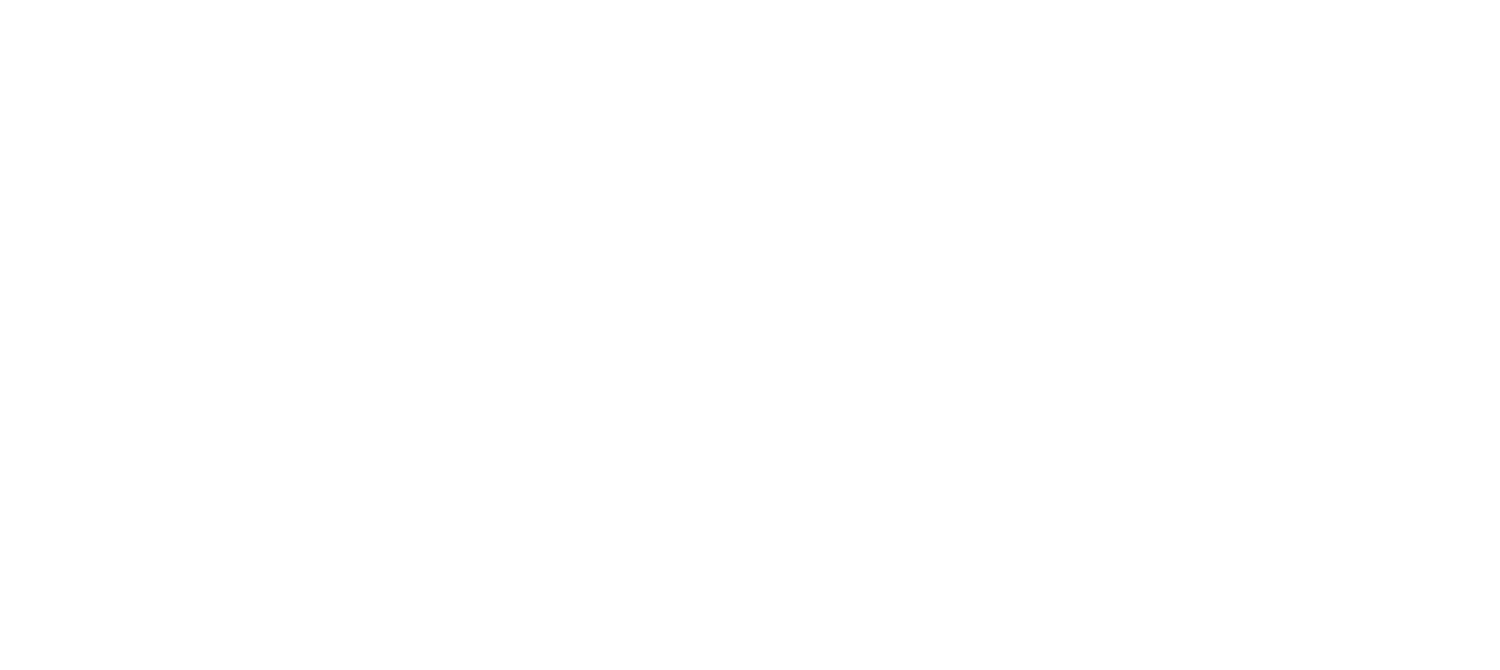

Die Klimakrise ist die zentrale Krise unserer Zeit. Viele Herausforderungen, vor die wir gestellt sind, hängen direkt mit ihr zusammen. Die 1,5-Grad Grenze haben wir bereits überschritten, das bedeutet jedoch nicht, dass wir jetzt aufgeben dürfen. Jedes zehntel Grad hat dramatische Folgen für uns Menschen, die Natur und den Planeten. Bei allen politischen Handlungen und Entscheidungen muss effektiver Klimaschutz oberste Priorität haben, damit sich Wetterextreme, Ernteausfälle und die damit einher- gehenden humanitären Krisen nicht noch weiter verschärfen. Die Hochschulen haben hier eine ganz besondere Schlüsselrolle. Sie sind der Ort, an welchem durch Forschung Mittel erarbeitet werden, mit denen wir die Folgen der Klimakrise einbremsen.
können. Als Orte der zukunftsfähigen Wissenschaft müssen sie mit gutem vorangehen und ihre Treibhausemissionen drastisch reduzieren – das Ziel muss das Erreichen der Klimaneutralität 2030 sein. Dazu brauchen wir einerseits technische Innovation, um ressourcen– und energieschonender leben zu können, insbesondere auch um die Folgen der Klimakrise besser abschwächen zu können. Andererseits braucht es aber auch neue Gesellschafts– und Wirtschaftssysteme, denn es kann keinen öko-logisch-nachhaltigen Kapitalismus geben. Es ist allerhöchste Zeit, Maßnahmen zu treffen, um einen Systemwechsel herbeizuführen. Wir wollen alle Hebel in Bewegung setzen und uns lautstark einsetzen – für eine nachhaltige Hochschule, eine nachhaltige Gesellschaft und ein nachhaltiges System für alle.
Auch wenn die Zeit knapp wird ist für uns klar: Hochschulen können und sollen bis 2030 klimaneutral werden. Damit das noch gelingen könnte braucht es, gerade jetzt:
- Dekarbonisierungs- und Begrünungspläne von allen Hochschulen
- nachhaltige Beschaffungsstrategien
- Umstellung auf nachhaltige Energiequellen bei der Stromanschaffung
- bestehende Gebäude sanieren und Neubauten nur mit Photovoltaik und Dämmkonzepten.
- klimafreundliche Finanzierungen (Abzug von Geldern aus klimaschädlichen Investments)
- Reduktion der klimaschädlichen Mobilität des Hochschulpersonals und Lehrenden (Flugreisen nur wenn andere Optionen unzumutbar sind – nicht mehr aus Bequemlichkeit)
- Fuhrpark der Hochschulen deutlich reduzieren
- Umstellung der Mensen auf regionalere und saisonalere Verpflegung und Förderung von veganer Kost.
Klimaschutz soll institutionell fest in der Strategie und Organisation der Hochschulen integriert sein, z. B. durch:
- Klimaschutzbeauftragt
- Thematisierung der Klimakrise als größte Krise unserer Zeit in allen Curricul
- Förderung interdisziplinärer Forschung zu Klimafragen
- Förderung der zugänglichen und niederschwelligen Kommunikation von Klimaforschung
- klimaverträglichen Campusbetrieb (erneuerbare Energien, pflanzliche Mensa-Angebote etc.)
Drittmittelfinanzierung von fossilen Konzernen soll abgelehnt werden. Zudem fordert die GRAS:
- die Einrichtung eines Klimakatastrophenfonds
- ernsthafte und konsequente Umsetzung der Forderungen des von der ÖH initiierten „Klimarats der Hochschulen“
Einführung eines eigenen Hochschul-Klimaschutzgesetzes mit sanktionierbaren Zielen. Darüber hinaus:
- verpflichtende Klima-Lehrveranstaltungen in allen Curricula
- klimaorientierte Forschung zugänglich und verständlich machen
- Klimakrise als Thema in allen Fakultäten verankern
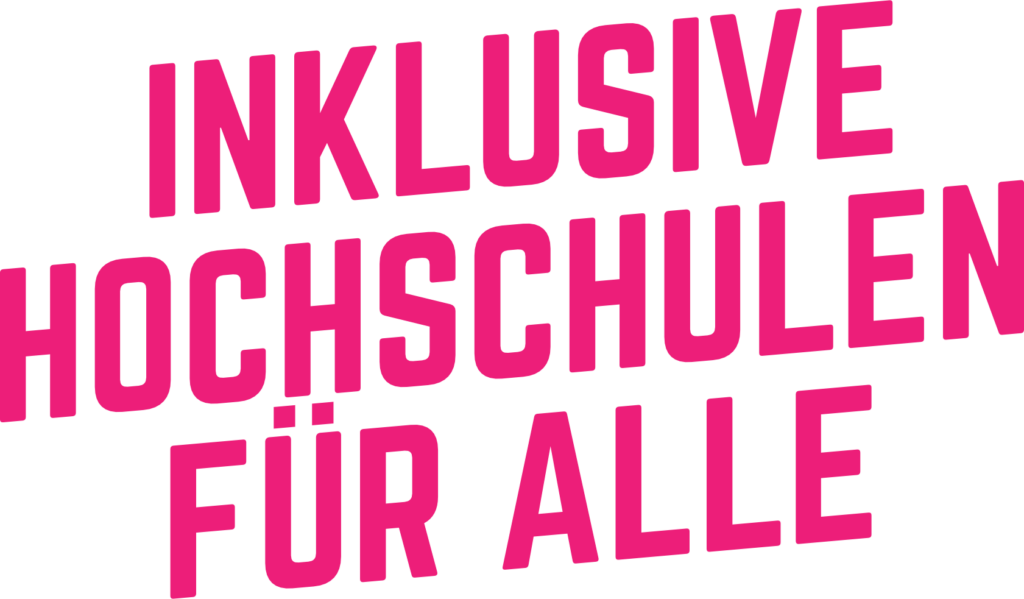
Diskriminierende Strukturen aller Art sind tief in unserer Gesellschaft und damit auch an als offen und progressiv geltenden Hochschulen verankert. Es gibt unzählige Fälle von sexualisierten Übergriffen und Catcalling, Studierende werden in Lehrveranstaltungen und Hochschulsystemen gedeadnamed1, BIPoCs (Black, Indigenous, People of Colour) sind in Vorlesungen mit rassistischen Strukturen und Übergriffen konfrontiert und von barrierefreien Hochschulen sind wir noch weit weg. Wenn Mitstudierende und Lehrende diskriminierende Arbeitsweisen reproduzieren und rassistische, homo–, bi–, trans- oder islamophobe, antisemitische, ableistische oder klassizistische Wortmeldungen tätigen,
können und wollen wir nicht wegschauen.
Jegliche Form von Diskriminierung ist mit einer solidarischen und offenen Gesellschaft nicht vereinbar. Die GRAS kämpft gegen alle menschenverachtenden Strukturen an und packt die Probleme an ihrer Wurzel: Deswegen kämpfen wir für die Zerschlagung des Hetero Cis–Patriarchats, eine antifaschistische und diskriminierungsfreie Gesellschaft und das bewusste Ablegen von kapitalistischen Denk– und Handlungsweisen, damit alle Studierenden chancengerechten und freien Zugang zu Gesellschaft und Hochschulen haben.
- Bekämpfung aller Diskriminierungsformen (rassistisch, queerfeindlich, ableistisch etc.) an Hochschulen.
- Verpflichtende Schulungen für Lehrende zu Diskriminierungsthemen.
- Repräsentative Hochschulgremien: Quotenregelungen für FINTA*-Personen und andere marginalisierte Gruppen.
- Sanktionen bei diskriminierendem Verhalten.
- Einrichtung niederschwelliger Meldestellen für sexualisierte Übergriffe und Diskriminierung.
- Awareness-Konzepte für Veranstaltungen mit über 300 Personen.
- Rechtliche Beratung für Betroffene durch die ÖH.
- Freie Namenswahl und Pronomen-Angabe im Hochschulsystem, inkl. der Möglichkeit zur korrekten Aussprache.
- Einrichtung von All-Gender-Toiletten und -Umkleiden.
- Stärkung der Gender Studies und queerfeministische Lehre in allen Studiengängen.
- Gendersensible Sprache in Wort und Schrift.
- Barrierefreie Hochschulen und Infrastruktur: Gebäude, Hörsäle, Websites, Lernunterlagen, Vorlesungen.
- Ausbau der ÖGS-Kurse (Österreichische Gebärdensprache) und generellen Sprachkursen und -unterstützungsangeboten.
- Mentale Gesundheit: Ausbau psychologischer Beratung, entstigmatisierende Maßnahmen.
- Studienfreundliche Regelungen: In Hitzephasen und generell: Cool Spaces, verpflichtende Online-Streams, Menstruationsschmerzen als anerkannter Entschuldigungsgrund
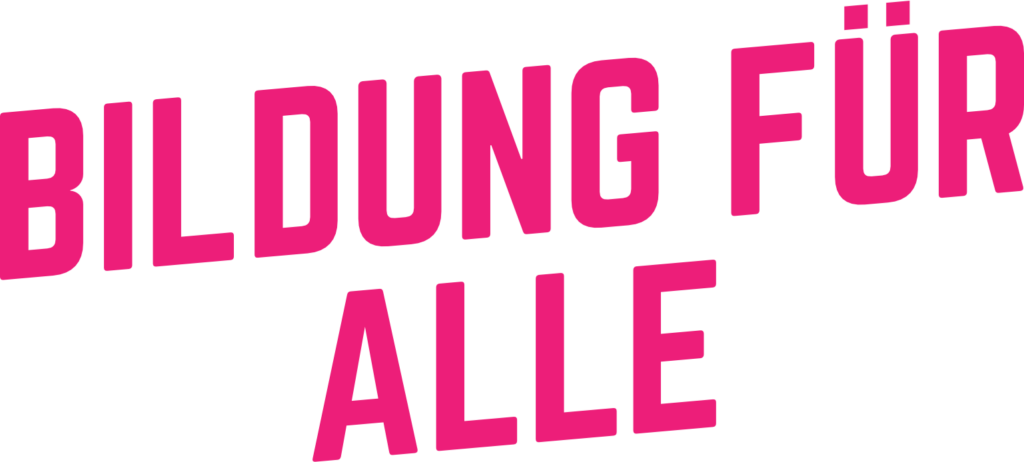
Bildung ist ein Menschenrecht und darf nicht von kapitalistischen Verwertungslogiken bestimmt werden. Dennoch werden Studiengänge, die nicht unmittelbar monetär verwertbar sind, häufig als „Feel-Good-Studiengänge“ abgetan. Warum sollte ein Bachelor in Byzantinistik weniger wert sein als ein Abschluss in Betriebswirtschaftslehre? Warum genießen manche Studiengänge – dank starker Drittmittelfinanzierung
– hochqualitative Lehre mit exzellenten Lernmaterialien und einem guten Betreuungsschlüssel, während andere Studienrichtungen um grundlegende Ressourcen kämpfen müssen?
Und warum unterscheiden sich Mitbestimmungsrechte der Studierenden so drastisch zwischen
den Hochschulsektoren?
All das sind Fragen, die wir uns stellen, und gleichzeitig Probleme, die wir angehen wollen.
Das Bildungs– und somit auch das Hochschulsystem in Österreich sind weiterhin kapitalistisch geprägt und leistungsorientiert. Leistungsdruck, wirtschaftliche Verwertbarkeit und Konkurrenz stehen im Vordergrund. Freie Bildung bedeutet für uns, dass alle Studierenden ihre Interessen und Stärken frei entfalten können –ohne finanzielle
Hürden, elitäre Ausschlussmechanismen oder ökonomische Zwänge – und damit einen wertvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten können.
- völlige Streichung und Abschaffung der Studiengebühren
- Grundstipendium für alle Studierenden, Studium ohne finanzielle Notstände unabhängig vom Einkommen der Eltern ermöglichen
- Staatlich ausfinanzierte Hochschulen, um Abhängigkeit von Drittmitteln zu vermeiden
- Gleichwertigkeit aller Studienrichtungen – auch sogenannter „nicht-verwertbarer“ Fächer wie Byzantinistik oder Gender Studies
- hoch-qualitative Studiengänge durch mehr Budget
- Keine Zugangsbeschränkungen durch Aufnahmetests oder Mindestleistungen
- Echte Studieneingangs- und Orientierungsphase statt versteckter Selektionsmechanismen
- Flexible Studiengestaltung, angepasst an Lebensrealitäten (z. B. Job, Betreuungspflichten)
- Erleichterte Beurlaubung, auch unter Erhalt von Förderungen
- Repräsentation von Studierenden in allen Gremien (z. B. durch Viertelparität)
- Hochschulwatch-Plattform zur Offenlegung von Unternehmenskooperationen
- Vereinheitlichung der Rechte aller Hochschultypen (Uni, FH, PH, Privatunis) für mehr Gerechtigkeit
- Keine kostenpflichtige Pflichtliteratur
- Anrechnung von Praxiserfahrungen und fair vergebene ECTS
- Barrierefreie, modernisierte Lerninfrastruktur
- Ausbau von Beratung, Kinderbetreuung und Unterstützungsangeboten – speziell auch für First-Gen-Studierende
- Unterstützung der Studierenden auch außerhalb der Hochschulen – das Leben der Studierenden endet nicht an den Toren der Hochschulen
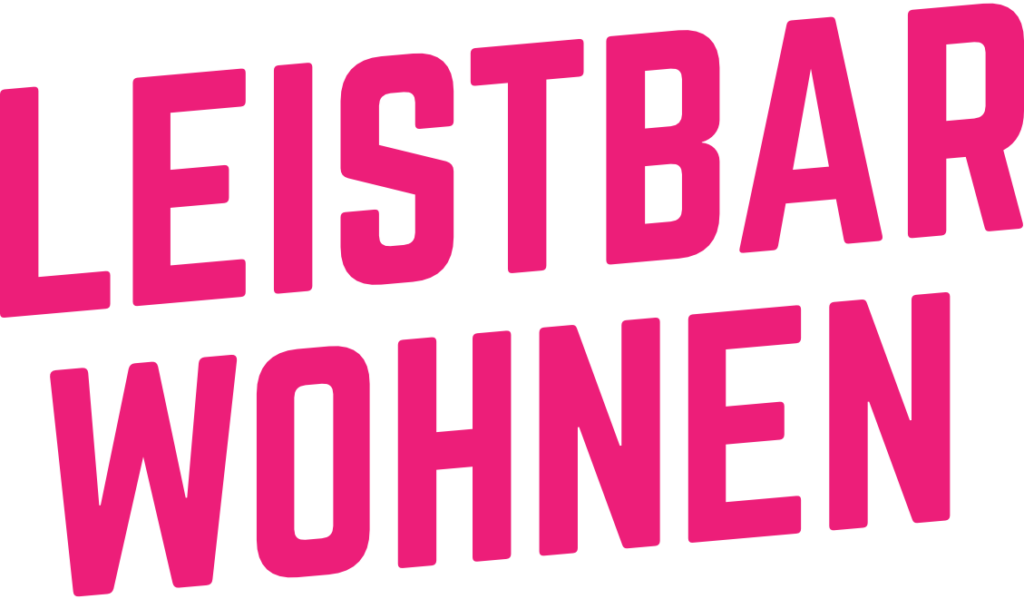
Leistbares Wohnen ist eine grundlegende Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und Chancengerechtigkeit. Besonders Studierende erleben häufig eine massive Wohnungsnot: Hohe Mieten, keine zeitgemäßen und überteuerte Studi–Wohnheime und fehlende Alternativen machen Wohnen für Studierende häufig zum realen Albtraum. Zusätzlich spiegeln sich auch im Wohnraum soziale Ungleichheiten und diskriminierende Strukturen wider: Steigende Mieten, Verdrängungseffekte und “Green-Gentrification” führen dazu, dass einkommensschwache Menschen, BIPoCs, queere Personen und Menschen mit Behinderungen besonders stark von Wohnungsnot betroffen sind.
Während wohlhabendere Bevölkerungsgruppen von klimafreundlichen Modernisierungsmaßnahmen profitieren, werden vulnerable Gruppen häufig aus ihren Wohnvierteln verdrängt. Gleichzeitig
stehen zahlreiche Gebäude leer, die für leistbares und klimagerechtes Wohnen genutzt werden könnten.
Eine sozialgerechte Klimapolitik im Wohnsektor muss sicherstellen, dass ökologische Maßnahmen nicht zu sozialer Ausgrenzung führen. Leistbares Wohnen und Klimaschutz dürfen nicht gegen- einander ausgespielt werden.
Sozialer Wohnbau muss Vorreiter für klimafreundliches Wohnen sein, Leerstände müssen konsequent bekämpft und nachhaltige Stadtentwicklung gefördert werden. Wir kämpfen für eine Wohnpolitik, die ökologische Verantwortung mit sozialer Gerechtigkeit verbindet. Für eine Stadtentwicklung, die niemanden zurücklässt. Für einen studierendenfreundlichen Wohnungsmarkt. Und für ein Recht auf Wohnen, das frei von Diskriminierung, Verdrängung und Ausgrenzung ist.
- Mietpreisdeckelung auch für Neubauten – nicht nur Altbau
- Unbefristete Mietverträge fördern statt kurzfristiger, teurer Zwischenlösungen
- Geförderter Wohnraum auch für Studis, unabhängig vom Erstwohnsitz
- Leistbare und zeitgemäße Studierendenwohnheime – Wiedereinführung der Studiwohnheimförderung
- Gemeindebau auch für Studierende öffnen
- Einführung eines Leerstandsmelders – leerstehende Gebäude sollen Studierenden zugänglich gemacht werden
- Konzepte für Zwischennutzung leerer Räume fördern
- Sozial gerechter Umgang mit Sanierungen – gegen „Green Gentrification“ und Verdrängung
- Wohnungskautionsfonds für Studierende – Vorbild: Graz und Salzburg
- Bundesweite Wohnbeihilfe, auch für WG-Zimmer & Wohnheime
- Förderungen für Energieeffizienz (z. B. Sanierung, Hitzeschutz, Umstieg auf erneuerbare Energien)
- Ausbau der kostenlosen Wohnrechtsberatung – mehrsprachig & niederschwellig
- Studierenden-Mietregister zur Vergleichbarkeit von WG-Zimmern & Mietkonditionen
- Nutzung & Sanierung von Bestandsgebäuden statt Neubauten, wo möglich

Viel zu oft bleiben die Stimmen der Studierenden ungehört, weil sie in Gremien der Hochschule unterrepräsentiert sind oder die Strukturen, um auf sich aufmerksam zu machen, vollkommen fehlen. Wenn dies der Fall ist, ist es für uns als GRAS klar, dass es die Pflicht der Österreichischen Hochschüler_innenschaft ist, effektive Vertretungsstrukturen einzufordern und sich dafür einzusetzen, dass diese auch gesetzlich verankert werden. Eine starke studentische Stimme in Entscheidungsprozessen ist Voraussetzung dafür, dass hochschulpolitische Entscheidungen nicht an den Bedürfnissen der Studierenden vorbei getroffen werden.
Die österreichische Hochschullandschaft ist
in die vier Sektoren aufgeteilt: Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen und Privatuniversitäten. Wir setzen uns für eine Vereinheitlichung der Rechtslage für diese Sektoren ein, damit Studierende weitestgehend dieselben Rechte und Pflichten gegenüber ihrer Hochschule haben. Vor allem Studierende an Hochschultypen, die im Privatrecht verankert sind, müssen stärker unterstützt werden. Denn gerechte Bildung bedeutet auch gerechte Strukturen an allen Hochschultypen. Als GRAS setzen wir uns für eine Hochschullandschaft ein, die niemanden ausschließt, gleiche Chancen für alle bietet und Studierende in den Mittelpunkt stellt – unabhängig vom Hochschultyp, an dem sie studieren.
- Vereinheitlichung der rechtlichen Rahmenbedingungen zwischen Universitäten, FHs, PHs und Privatunis
- Gleiche Mitbestimmungsrechte und Studienbedingungen – unabhängig vom Hochschultyp
- Keine Studiengebühren mehr an FHs
- Stärkere studentische Mitbestimmung in FH- und PH-Strukturen, insbesondere in Lehramtsverbünden
- Gleiches Mitspracherecht wie andere Hochschulgruppen in Entscheidungsprozessen
- Entlastung bei verlangten Pendeln durch Verbünde
- Verstärktes hybrides Angebot bei Lehrverbünden um unnötige lange Pendelwege zu vermeiden
- Reduktion der Anwesenheitspflicht, mehr Wahlmöglichkeiten im Curriculum
- Erleichterte Anrechnung von Vorleistungen, auch von anderen Hochschulen
- Einführung eines freiwilligen 5. Prüfungsantritts, auch für Notenverbesserung
- Mehr Praxis mit guter theoretischer Einbettung
- Keine kosmetischen Lösungen beim Lehrer_innenmangel – stattdessen Attraktivierung des Berufs und des Studiums
- Faire ECTS-Vergabe für Lehramtsstudierende im Vergleich zu Fachstudierenden im selben Kurs

Viele Studierende sind auch neben ihrem Studium Kunst– und Kulturschaffende. Dabei sollte Kunst und Kultur von Studierenden gefördert werden, stellen sie doch ein zentrales Medium dar, um Thematiken, Probleme und Politisches zu kommunizieren, die Studierende bewegen.
Kunst schafft Räume für kritisches Denken, inspiriert zum Hinterfragen gesellschaftlicher Strukturen und ermöglicht neue Perspektiven auf soziale, ökologische und politische Herausforderungen. An den Hochschulen muss dieser Betrieb also mehr Platz finden und es müssen bessere Rahmenbedingungen ermöglicht werden, damit Kunstschaffen neben dem Studium nicht mit prekären
Lebensbedingungen einhergeht. Außerdem fordern wir, dass Kunst und Kultur allen Studierenden zugänglich sein müssen. Wenn alle finanziellen Mittel schon auf die Deckung von Grundbedürfnissen draufgehen, sind Kinobesuche, Museumsnachmittage und Konzerte oft außerhalb des finanziell möglichen Rahmens für Studierende. Kunst und Kultur dürfen kein Luxusgut sein, das nur wenigen vorbehalten ist.
Daher braucht es dringend Vergünstigungen, kostenfreie Kulturangebote und Kooperationen zwischen Hochschulen und Kultureinrichtungen, um allen Studierenden kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.
- Fördertöpfe für kunstschaffende Studierende, insbesondere für FINTA*-Personen und armutsgefährdete Gruppen
- Streichung von ECTS-Mindestleistungen und spezielle Beurlaubungsregelungen, um Kunst und Studium besser vereinbaren zu können
Kultur darf kein Luxusgut sein – daher braucht es:
- kostenfreie Kulturangebote
- Vergünstigungen für Kino, Theater, Museen etc.
- Kooperationen zwischen Hochschulen und Kultureinrichtungen
- Ausbau von Hörsaalkinos, Konzerten, Ausstellungen
- Plattformen zur Präsentation studentischer Kunst (z. B. Hochschulräume, Progress-Magazin)
- Kulturangebote sollen von Hochschulen, der ÖH und Studierenden selbst organisiert werden
- Bundesweiter Kulturpass mit freiem Eintritt zu Museen, Kinos, Theatern usw.
- Vorbild: Frankreichs Kulturpass mit Guthaben für Kulturkonsum

Digitalisierung und Internationalität sind zentrale Bausteine einer modernen Hochschullandschaft.
Doch auch hier zeigen sich massive Ungleichheiten. Während einige Hochschulen Vorreiter in digitaler Lehre und internationaler Vernetzung sind, kämpfen andere mit veralteter Infrastruktur, fehlender digitaler Barrierefreiheit und eingeschränkten Austauschprogrammen. Für viele Studierende bleiben internationale Erfahrungen aufgrund finanzieller Hürden oder bürokratischer Prozesse unerreichbar.
Gleichzeitig birgt die Digitalisierung, die flexibles Lernen ermöglicht, auch Risiken wie soziale Isolation und die Verschärfung von Ungleichheiten
Wir fordern verstärkte Digitalisierung an Hochschulen, die Studierende in den Mittelpunkt stellt: barrierefrei, zugänglich und ressourcenschonend. Digitale Lehrformate müssen qualitativ hochwertig sein, hybride Lernangebote sollten den Zugang zu Bildung erleichtern und nicht
erschweren.
Digitale Infrastruktur darf kein Privileg einzelner Hochschulen bleiben – sie muss flächendeckend und nachhaltig gefördert werden. Zusätzlich muss ein vernünftiger und verantwortungsvoller Umgang im digitalen Raum gefördert werden.
Internationalität darf nicht vom sozialen Hintergrund abhängen. Mobilitätsprogramme, Auslandssemester und internationale Kooperationen müssen für alle Studierende zugänglich sein – unabhängig vom Einkommen oder vom Studiengang. Es braucht mehr finanzielle Unterstützung, transparente Anerkennungsverfahren und weniger bürokratische Hürden. Gleichzeitig muss Internationalität kritisch gedacht werden:
Globale Vernetzung bedeutet auch globale Verantwortung. Internationale Zusammenarbeit darf nicht auf Prestigeprojekte beschränkt sein, sondern muss einen Beitrag zu sozialer und ökologischer Gerechtigkeit leisten.
- Flächendeckender Zugang zu moderner IT-Infrastruktur
- Kostenlose oder günstige Bereitstellung von Laptops, Webcams etc.
- Einheitlicher Login für alle digitalen Hochschuldienste
- Recht auf Vorlesungsaufzeichnungen & digitale Prüfungen
- Hybride Formate und flexible Gestaltung ermöglichen Vereinbarkeit mit Job, Pflege etc.
- Digitalisierte Bücher & Literaturzugang online
- Digitale Lehre soll nicht soziale Ungleichheiten verstärken
- Bewusster Umgang mit Online-Räumen (z. B. Schutz vor Überwachung, Cybersicherheit)
- Offener Zugang zu Lehr- und Lernmaterialien
- Einheitliche Kalenderintegration und Tools für Studierende aller Hochschulen
Keine Diskriminierung von Drittstaatsstudierenden mehr
- Abschaffung von doppelten Studiengebühren & diskriminierenden Mindestleistungen
- Internationale Zusammenarbeit soll sozial & ökologisch gerecht gestaltet sein – keine reinen Prestigeprojekte
Mehrsprachige & unterstützende Angebote
- Infos auf Englisch, BKS, Arabisch etc.
- Ausbau von Beratungsteams für ausländische Studierende
- Kostenlose Sprachkurse & -zertifikate
- Mehr finanzielle Unterstützung für Erasmus & Auslandssemester (z. B. Unterkunft, Verdienstausfall)
- Weniger Bürokratie & transparente Anerkennungsverfahren
